Allgemeines
Lehrende
Dr. Sara Studte

Veranstaltung
Gedächtnisentwicklung bei Kindern und Jugendlichen
Modul
biw220 – Psychologische Grundlagen
Studiengang
Zwei-Fächer-Bachelor-Studiengang (Berufsziel Lehramt)
Fakultät
Fakultät I – Bildungs- und Sozialwissenschaften
Institut
Institut für Pädagogik – Pädagogische Psychologie
Semester
WiSe 2023/2024
Turnus
wöchentlich
Anzahl Studierende
42
KP des Moduls
6 (3 KP für das Seminar)
Prüfungsform
keine
Kategorien
Bildungswissenschaften und Pädagogik
Forschendes Lernen
Seminar
Stud.IP
Wir alle brauchen unser Gedächtnis tagtäglich in den verschiedensten Kontexten. Sei es beim Einkaufen (ohne Liste – oder zumindest die Erinnerung daran, wo die Liste hingesteckt wurde), beim Sprechen (ganz generell!), aber natürlich auch beim Kommunizieren mit Freunden und Familie (was waren die letzten Themen, was sind gemeinsame „Erinnerungen“…), bei der Organisation unserer „to dos“ oder wichtiger (und unwichtiger) Termine. Auch der zu einem gewissen Zeitpunkt gezielte – und hoffentlich erfolgreiche – Abruf von Wissen macht das (funktionierende) Gedächtnis unerlässlich. Und dies nicht erst in späteren Jahren, sondern bereits im primären Schulbereich.
Seminare im universitären Kontext sind oftmals so gestaltet, dass z. B. Referate zu Erkenntnissen, die bereits bestehen, durchgeführt werden. In diesem Seminar war es jedoch ein Anliegen, dass ein empirischer, selbst gewählter, Zugang in Bezug auf die Gedächtnisentwicklung von Kindern (und Jugendlichen) vorgenommen werden kann. Somit wurden die Studierenden in diesem Semester selbst zu Forschenden, indem sie einen gesamten Forschungsprozess (mit Unterstützung) durchliefen. Von diesem Setting war zu erwarten, dass die Studierenden aktiv und selbstständig verschiedene Lernprozesse, auf inhaltlicher sowie methodischer Ebene, durchlaufen und dadurch sowohl eine bessere individuelle Verknüpfung mit dem Vorwissen erfolgen würde als auch verschiedene (forschungs-) relevante Schlüsselkompetenzen gestärkt und reflektiert werden könnten. Die Studierenden entwickelten unter Anleitung, und nach der Literaturrecherche, verschiedene Fragestellungen, um sich an dieses (sehr umfangreiche) Thema Gedächtnisentwicklung heranzutasten. Es wurde ein gemeinsames Forschungsdesign nicht nur entwickelt, sondern auch praktisch im Semester umgesetzt. Gemeinsam erfolgte dann eine Auswertung der erhobenen Daten sowie eine Interpretation der statistischen Auswertung, bevor die Ergebnisse sowohl präsentiert als auch verschriftlicht wurden.

Inhalte und Lernziele
Thematisch bewegt sich das Seminar im Bereich des komplexen Interaktionsspiel von „Gedächtnis“ und „Entwicklung“. Der Schwerpunkt liegt dabei im Altersbereich von etwa 7-12 Jahren, um die Umsetzung innerhalb eines Semesters überhaupt realisieren zu können. Als Vergleichsgruppe dienen junge Erwachsene (Studierende) im Alter von etwa 18 bis 23 Jahre. Beim Gedächtnis werden sowohl Entwicklungsaspekte des Arbeitsgedächtnisses (AG) nach dem Modell von Baddeley (1986), d. h. phonologische Schleife, visuell-räumlicher Notizblock und zentrale Exekutive als auch des expliziten Langzeitgedächtnisses (LZG) betrachtet. Das Seminar beinhaltet dabei mehrere Lernziele, indem folgende Punkte erfolgreich durchlaufen werden:
- Eine selbstständige und gut durchdachte Literaturrecherche (welche Quellen sind geeignet, worauf sollte geachtet werden?)
- Die Entwicklung eines gemeinsamen Forschungsdesign (wie bekommen wir alle Fragestellungen in einem gemeinsamen Setting untergebracht?)
- Wo kommen die Studienteilnehmer:innen her? Eine gemeinsame und koordinierte Versuchspersonensuche ist unerlässlich, um die Studie durchführen zu können! Weitere wissenschaftliche Aspekte (Randomisierung, Anonymität, ethische Aspekte, Datenschutz, …) gehören ebenfalls zu den beachteten Punkten.
- Eine souveräne Durchführung der Studie (Einarbeitung, Absprachen, gemeinsame Instruktionen nutzen).
- Eine Auswertung der Daten (unter Anleitung und mit Hilfe der Dozierenden) sowie Einbettung in den theoretischen und empirischen Forschungsstand
- Präsentation und Austausch der Ergebnisse
- Sowie deren Interpretation
- Eine gemeinsame abschließende Reflektion des Seminars sowie Forschungsprozesses
Aktivitäten der Studierenden bzw. Methodenauswahl
Das Seminar beginnt mit einer thematischen sowie praktischen Verortung in Bezug auf das Oberthema (Gedächtnisentwicklung) sowie des Formats (Forschendes Lernen). Im Wechsel gibt es Input durch die Dozierende und Gruppenarbeitsphasen, deren Resultate dann im Plenum besprochen und diskutiert werden. Nach Festlegung der Interessensschwerpunkte werden im weiteren Verlauf Literatur recherchiert und Fragestellungen erarbeitet (selbstständig durch die Studierenden), bevor diese gemeinsam mit der Dozierenden besprochen, reflektiert und ggf. überarbeitet werden.
Parallel zu diesen Schritten wird ein Ethikantrag (durch die Dozierende und die studentische Hilfskraft, da die Einreichfrist sehr früh [08.11.2023] im Semester liegt) vorbereitet. Bevor der Ethikantrag eingereicht wird, müssen sowohl das gemeinsame Forschungsdesign fertig gestellt werden sowie die selbst (innerhalb der Kleingruppen) erstellten Fragebögen, die z. B. die Mehrsprachigkeit oder die Mediennutzung abfragen. Des Weiteren wird das Informationsmaterial und die Einwilligungserklärung für die Erziehungsberechtigten bzw. für die erwachsenen Teilnehmer*innen vorbereitet.
Die drei Gruppen, welche die Entwicklung des Langzeitgedächtnisses untersuchen wollen, erstellen gemeinsam ein eigenes Lernset mit Bild- und Audiomaterial. Die vier Gruppen, die im Bereich der Arbeitsgedächtnisentwicklung forschen wollen, arbeiten sich in die Arbeitsgedächtnistestbatterie (AGTB 5-12; Hasselhorn et al., 2012) ein und wählen geeignete Untertests, um ihre Forschungsfragen beantworten zu können. Parallel wird durch die studentische Hilfskraft ein Flyer zur Probandenrekrutierung gestaltet, der dann online (Stud.IP) bzw. analog durch die Seminarteil-nehmenden verteilt wird. Für die Erhebungsnachmittage (12.12.23-15.01.24) gibt es Testleiter*innen-Listen, in denen sich die Seminarteilnehmenden eintragen können. Da es drei parallel nutzbare AGTB-Arbeitsplätze gibt, können bis zu 3 Probanden gleichzeitig an einer Sitzung teilnehmen. Die Testleiterteams bestehen dabei aus zwei Personen der LZG-Gruppen sowie drei Personen der AG-Gruppen, wenn drei Versuchspersonen gleichzeitig getestet werden. Bei Bedarf springt die studentische Hilfskraft, oder die Dozierende, als Testleiterin ein. Bei jeder Testung ist entweder die Dozierende oder die studentische Hilfskraft zusätzlich als Versuchsleiterin anwesend. Jede*r Seminarteilnehmer* soll an mindestens einer Erhebung als Testleiter*in beteiligt sein, um auch diesen Aspekt des Forschungsprozesses kennenzulernen. Für 41 der 42 Seminarteilnehmenden gelingt dies auch.
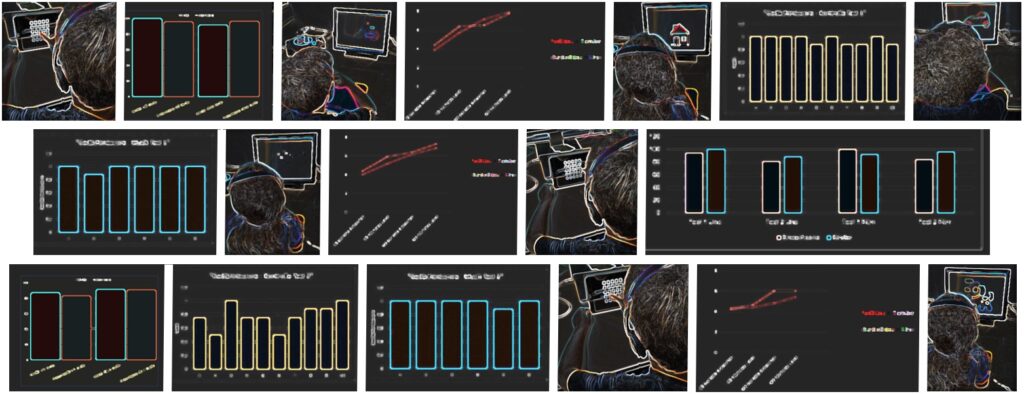
Die Datenübertragung sowie -auswertung wird durch die Gruppen, mit Unterstützung der Dozentin sowie der studentischen Hilfskraft, durchgeführt. Der vorletzte Seminartermin (23.01.24) dient der gemeinsamen Reflektion des gesamten Seminars und Forschungsprozesses. Eine Mini-Konferenz am 30.01.24 beschließt das Seminar. Alle Gruppen stellen mittels kurzer Vorträge (10 Minuten) ihre Ergebnisse (vgl. Abb. 1) vor, bevor diese mit dem Plenum diskutiert werden. In Hinblick auf das wissenschaftliche Schreiben sind die Gruppen abschließend gefordert, einen (sehr) kurzen Artikel zu schreiben (2-3 Seiten Text). Um dafür eine gemeinsame Basis zu schaffen (aufgrund sehr unterschiedlicher Vorerfahrungen), erstellt die Dozentin eine Art „Checkliste“, mit den wichtigsten zu beachtenden Aspekten. Anhand dieser erhält jede Gruppe ein ausführliches Feedback zu der eingereichten schriftlichen Ausarbeitung.
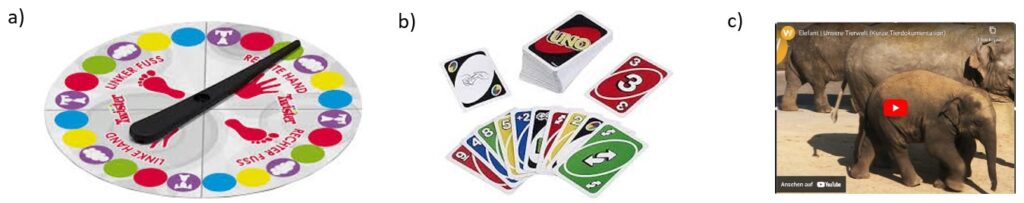
Erfahrungen
Ganz grundsätzlich: 42 Teilnehmer*innen (1.-5. Semester in einem Bachelor-Studiengang) in einem einsemestrigen Forschungsprojekt erfordern eine Menge Organisations- sowie Koordinationseinsatz der Lehrenden und auch der studentischen Hilfskräfte. Auch eine gewisse zeitliche Flexibilität aller Beteiligten war notwendig, da die Durchführung der Studie nur nachmittags nach Schulschluss möglich war. Da den (insgesamt sieben) Gruppen der Schwerpunkt ihrer Teilstudie nicht vorgegeben wurde, ergab sich eine „bunte“ Mischung (vgl. Abb. 2) an verschiedenen Aspekten, die untersucht werden sollten. Dies war auf der einen Seite sehr interessant zu begleiten, auf der anderen Seite erhöhte sich der Arbeitsaufwand auf Seiten der Lehrenden dadurch um ein Vielfaches (verglichen z. B. mit einer festen Vorgabe dazu, was wann wie untersucht werden soll). Durch dieses Format entwickelten oder vertieften die Studierenden jedoch eine Reihe von Kompetenzen, wie z. B. das Recherchieren geeigneter Inhalte sowie des Formulierens von (beantwortbaren) Fragestellungen und den Herausforderungen im Zuge von Forschungsprozessen zu begegnen. Zusammenfassend war es jedoch nicht nur auf Seiten der Studierenden eine wertvolle Erfahrung, selbst einmal diesen Forschungsprozess (ohne Notendruck) durchlaufen zu können, es war auch für die Lehrende eine bereichernde Erfahrung, dieses Seminar (beg-)leiten zu können.
Literatur
Baddeley, A. (1986). Working memory (vol. 11). In: Oxford: Oxford University Press, Clarendon Press.
Hasselhorn, M., Schumann-Hengsteler, R., Gronauer, J., Grube, D., Mähler, C., Schmid, I.,…Zoelch, C. (2012). Arbeitsgedächtnistestbatterie für Kinder von fünf bis zwölf Jahren:(AGTB 5-12).

