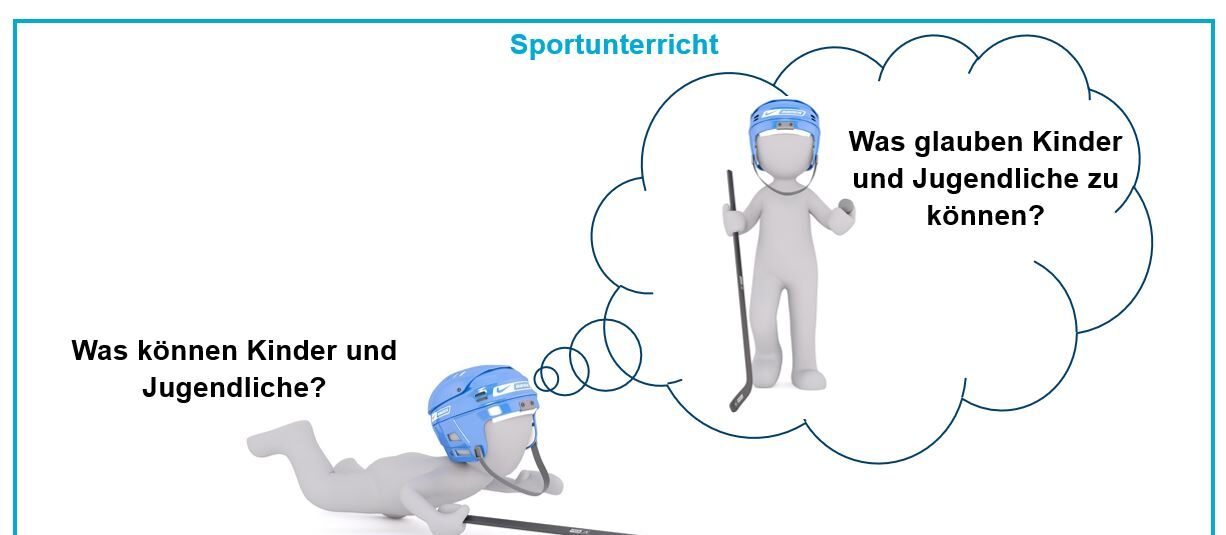Allgemeines
Lehrende
Dr. Katharina Pöppel

Veranstaltung
Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung des Projektbands Sport
Modul
prx566 – Projektband
Studiengang
GHR 300 (M. Ed. Grundschule Sport, M. Ed. Haupt- und Realschule Sport)
Fakultät
Fakultät IV – Human- und Gesellschaftswissenschaften
Institut
Institut für Sportwissenschaft
Semester
WiSe 2022/23
SoSe 2023
WiSe 2023/24
Turnus
vierzehntägig
Anzahl Studierende
3
KP des Moduls
10
Prüfungsform
Portfolio
Kategorien
Forschendes Lernen
Projekt
Seminar
Sportwissenschaft
Stud.IP
Neben sportmotorischen Kompetenzzuwächsen intendiert der Sportunterricht u. a. eine Förderung der Selbstkompetenz der Schüler*innen. Hierzu zählt eine realistische Selbsteinschätzung, um beispielsweise mit Risiken und Wagnissen entsprechend des individuellen Leistungsvermögens umgehen zu können (z. B. Niedersächsisches Kultusministerium, 2020). Durch die COVID-19-Einschränkungen des Sportunterrichts und den temporären Ausfall vereinsbezogener Sportangebote haben Kinder und Jugendliche in den pandemiegeprägten Jahren keine ausreichende Förderung ihrer Sport- und Bewegungskompetenzen erfahren (z. B. Kovacs et al., 2022). Dies kann als gravierend eingeschätzt werden, da in dieser Altersgruppe zentrale Fortschritte in der motorischen Entwicklung erfolgen (sollen) und der soziale Vergleich mit Gleichaltrigen für selbstbezogene Einschätzungen (z. B. Selbstkonzept) zentral ist. Um einen aktuellen Status quo zu erfassen, werden im Rahmen der Veranstaltung Antworten auf folgende Fragestellungen erarbeitet: Wie stellt sich die sportmotorische Leistungsfähigkeit von Heranwachsenden objektiv dar? Und wie schätzen Heranwachsende ihre Leistungsfähigkeit subjektiv ein? Flankiert durch drei konsekutive Seminare von Wintersemester 2023/24 bis Wintersemester 2024/25 führen die Studierenden eine empirische Studie durch, die eine Selbsteinschätzung sowie eine Testung der sportmotorischen Leistungsfähigkeit beinhaltet. Entsprechend des Forschenden Lernens erarbeiten sich die Studierenden kollaborativ (think-pair-share) den zugehörigen theoretischen und empirischen Hintergrund und erarbeiten Grundlagen der sportmotorischen Diagnostik. Unter Berücksichtigung forschungsethischer Richtlinien und Einholung von Genehmigungen erfolgte im Anschluss eine eigenständige Planung der Erhebung. Für die objektive Leistungserhebung wird der Deutsche Motorik-Test (DMT 6-18; Bös et al., 2016) als ein im deutschsprachigen Raum bewährtes und wissenschaftlich abgesichertes Instrument zur Diagnostik der motorischen Leistungsfähigkeit eingesetzt. Die Datenerhebungen erfolgten im Rahmen des 18-wöchigen Schulpraktikums (Praxisblock). Die Studie wird durch eine eigenständige Auswertung der Daten durch die Studierenden abgeschlossen.
Inhalte und Lernziele
Inhaltsbereiche der Veranstaltung:
- Motorische und psychische Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
- Theoretische Konzepte und fachdidaktische Grundlagen des Sportunterrichts
- Grundlagen der sportmotorischen Diagnostik
- Chancen, Grenzen und Herausforderungen von objektiven und subjektiven Erhebungsverfahren
- Untersuchungsplanung und -durchführung
Kompetenzziele (Anpassung entsprechend der prx566-Modulbeschreibung):
- Die Studierenden lernen, Ergebnisse der fachdidaktischen und -wissenschaftlichen Forschung kritisch und auf der Basis von Forschungsliteratur und empirischen Studien zu interpretieren sowie eigene Forschungsergebnisse und die Ergebnisse anderer kritisch und theoriegeleitet zu reflektieren.
Die Studierenden nehmen selbst eine forschende Haltung ein und gestalten, erfahren und reflektieren in eigenen kleinen Forschungen fachspezifisch wesentliche Phasen eines Forschungsvorhabens von der Entwicklung der Fragen und Hypothesen über die Wahl und Ausführung der Methoden bis hin zur Prüfung und Darstellung der Ergebnisse in aktiver Mitarbeit in einem übergreifenden Projekt.

Aktivitäten der Studierenden bzw. Methodenauswahl
Kollaboratives Lernen (v. a. think-pair-share)
Problemorientiertes sowie selbstreguliertes Lernen
Prüfung und Bewertung
Portfolio mit zwei Bestandteilen:
- Exposé: Entwicklung und Begründung einer Projektidee und Fragestellung (einschl. methodischem Vorgehen und Ablaufplan des Projekts) mit Darstellung der Relevanz für die schulische Praxis
- Mündliche Präsentation: Vorstellung, Diskussion und Reflexion des Projektes
Zur Erhöhung der Transparenz lagen den Studierenden die zugehörigen Bewertungskriterien zu Veranstaltungsbeginn vor.
Erfahrungen
Durch die Vorgabe der leitenden Fragestellungen (objektive und subjektive Erhebung der sportmotorischen Leistungsfähigkeit) hatten die Studierenden die Möglichkeit, sich in einem vorgegebenen Rahmen aktiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. In vorangegangenen Semestern habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Studierenden zu einem Gefühl der Überforderung tendieren und vergleichsweise weniger motiviert agieren, wenn sie sich komplett frei mit einem Oberthema auseinandersetzen.
Forschendes Lernen
Orientiert an Hubers (2013) Phasen des Forschenden Lernens erleben die Studierenden Freiheitsgrade im theoretischen und empirischen Einstieg in das Forschungsfeld sowie in der Möglichkeit eigene ergänzende Fragestellungen zu formulieren. Hierbei übernehmen sie Verantwortung für Forschungsprozess und -fortschritt der Gruppe. Im Rahmen der methodischen Umsetzung erfolgt eine stärkere Lenkung, z. B. durch Vorgabe eines geeigneten methodischen Zugangs. Die Aneignung des methodischen Vorgehens sowie die Durchführung und Auswertung initiieren die Studierenden weitgehend selbstständig und knüpfen hierbei an die forschungsmethodologischen Grundlagen des Bachelorstudiums der Sportwissenschaft an.